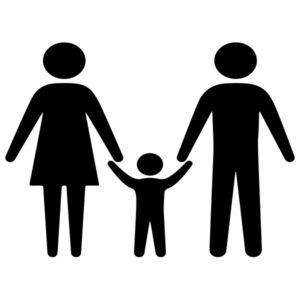Eigentlich mag ich München sehr, besonders die Isar und den Westpark und mit meiner Schule, dem dortigen Kollegium und den Schülerinnen und Schülern am Wilhelmsgymnasium hätte ich es auch kaum besser treffen können. Und trotzdem habe ich einen Versetzungsantrag gestellt. Warum das so ist und wo ich Verbesserungsmöglichkeiten sehe, beschreiben die folgenden Zeilen.
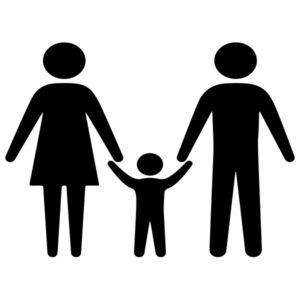
Ausgangslage
Seit mehr als 12 Jahren bin ich inzwischen in München und seit 9 Jahren wohne ich mit meiner besseren Hälfte und inzwischen auch mit meinem Sohn in einer tollen 56qm Zwei-Zimmer-Wohnung. Doch diese wird nun definitiv zu klein, sodass an einem Umzug kein Weg vorbei führt. Ich bin dabei nicht besonders anspruchsvoll, aber eigentlich brauchen wir 4, im Idealfall 5 Zimmer. Und damit sind wir dann am freien Mietmarkt bei ca. 2000 € Kaltmiete – Tendenz steigend. Staatsbedienstetenwohnungen und bezahlbare Wohnungen bei sozial ausgerichteten Vereinen oder Gesellschaften sind sehr rar. Beim Kaufen von Wohnraum dürfte es geschätzt (ohne mich hier wirklich informiert zu haben, weil finanziell unrealistisch) bei über einer Millionen, eher so 1,2 Millionen + x losgehen. Aber auch mit den sehr gesuchten Fächern Physik und Mathe bekomme ich als Lehrer in München eben „nur“ A13.
Regionalisierung der Familienzulage – die Idee
Genau dieses Problem der hohen Wohnkosten in Ballungsräumen soll der sog. Ortszuschlag reduzieren. Grundidee: In Regionen, wo das Leben besonders teuer ist, gibt es einen Zuschlag zum Gehalt, damit auch Stellen an diesen Orten attraktiv sind. Der Orts- und Familienzuschlag wurde gerade neu geregelt und ich zitiere mal das Bayerische Kultusministerium:
„[…] profitieren Sie – gerade im Ballungsraum München – von sehr guten Einstellungschancen und der Neuregelung des Orts- und Familienzuschlags, die in vielen Fallkonstellationen zu einer spürbaren Steigerung der Besoldung führt!“
(Quelle: https://www.km.bayern.de/lehrer/stellen/regionalpraemie.html; abgerufen am 04.05.2023
Ortszuschlag – Die traurige Realität
Da Lehrergehälter sehr transparent sind, kann man sich mit Hilfe von Gehaltsrechnern wie z.B. https://oeffentlicher-dienst.info ausrechnen, welche Auswirkungen der Wohnort auf das Gehalt hat. Mit A13, neuem Familienzuschlag bei einem Kind, meiner aktuellen Stufe 7, Steuerklasse IV und Kirchensteuer Bayern bleiben netto etwa 4125€, wovon noch etwa 400€ private Krankenversicherung für mich und den Nachwuchs abgehen. Natürlich kann ich bei dem Vergleichsnetto von 3725€ da auch 2000€ kalt irgendwie finanzieren. Aber ich bin eben auch Mathelehrer und mag Rechenspiele: In der niedrigsten Ortsklasse I bekäme ich etwa 4030€ raus, also sage und schreibe 95€ (!) weniger als in München. Das sind (gerechnet aufs Netto in München ohne PKV-Abzug) sensationelle 2,3% weniger. Damit folgt automatisch die Frage: „Was ließe sich mit 2000€-95€=1905€ an einem solchen Ort wohntechnisch finanzieren?“ Und die einfache Antwort ist: Definitiv deutlich mehr als in München, vielleicht sogar ein Arbeitszimmer. Die Gegenfrage dazu ist natürlich: „Gleicht München als Stadt diesen Unterschied wieder aus?“ Hierauf muss sicher jeder seine eigene Antwort finden.
Meine Schlussfolgerung
Für mich bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder einen besser bezahlten Job in der freien Wirtschaft suchen oder versuchen, den Ort zu wechseln. Und da ich das, was ich aktuell tue (ergänzt durch meine sonstigen Aktivitäten), sehr mag, es mir Spaß macht und ich auch immer wieder positives Feedback von Schüler:innen und Eltern bekomme, fällt mir die Entscheidung gerade leicht: Ich versuche den Ort zu wechseln und habe einen Versetzungsantrag gestellt. Mal sehen, wie groß der Lehrkräftemangel in Unterfranken tatsächlich ist oder ob der Mangel in München so groß ist, dass das Ministerium keine Versetzungsmöglichkeit sieht. Aber ich bin da erstmal ganz entspannt und warte ab, was passiert.
Verbeserungsmöglichkeiten
Meckern ist leicht, deswegen hier meine konkreten Verbesserungswünsche rund um den Versetzungsantrag, um den Lehrerberuf weiter attraktiv zu halten oder ihn zumindest im Vergleich nicht noch unattraktiver zu machen:
- Der Ortszuschlag sollte so gestaltet werden, dass er die realen Wohnkosten deutlicher ausgleicht – aktuell ist das eher ein Witz und ich fühle mich bei so minimaler Regionalisierung fast etwas mehr auf den Arm genommen, als es ganz ohne Unterscheidung der Fall war.
- Der Bedarf an allen Schulen sollte offener und transparenter kommuniziert werden, gerne auch ergänzt mit schulscharfen Stellenauschreibungen und Bewerbungsmöglichkeiten. Das würde zum einen eine echte Transparenz schaffen, wie groß der Lehrkräftemangel eigentlich ist, aber zum anderen würden Schulleitungen auch ansatzweise Möglichkeiten erhalten, Personal passend zu ihrem gewünschten Profil zu erhalten, was ja oft weit mehr umfasst, als nur die Unterrichtsfächer. Auch als Lehrkraft könnte man sich dann viel besser eine Schule oder ein Team suchen, dass zu einem passt. Ich denke, dass hätte für alle Seiten einen positiven Effekt und würde die Schulen besser machen.
- Auch wenn es bei mir nicht passiert: Die Schulleitung kann tatsächlich einen Versetzungsantrag 1x, also für ein Jahr ablehnen. Gelegentlich, bei etwa 4,4% aller Fälle, kommt das auch vor (siehe Zahlen des BPV). Ehrlich: das ist doch nicht sinnvoll. Welche Leistung erwartet man von einem Mitarbeiter, der eigentlich weg will und dessen Wunsch aktiv verhindert wird? Bitte einfach streichen.
Buschprämie
Noch kurz ein paar Worte zur „Buschprämie“, offiziell Regionalprämie, von einmalig 3000€ die Bayern jetzt für Neueinstellungen (betrifft mich also nicht) in verschiedenen Gebieten, meist an den Grenzen in Nord- und Ostbayern, zahlt: Ich war ehrlich überrascht, dass München und das gesamte Oberland ein leerer Fleck ist, der Lehrkräftemangel also in München und Umgebung im Vergleich mit anderen Regionen gering zu sein scheint. Das kann ich mir nur dadurch erklären, dass nach dem Ref sehr viele Abgänger nach München wollen oder geschickt werden, um hier Lücken zu füllen. Aber mit Blick auf sinkende Abgängerzahlen könnte das schwieriger werden in den kommenden Jahren. Ansonsten bin ich sehr gespannt, ob so ein geringer Betrag (nicht mal ein Monatsgehalt) tatsächlich Auswirkungen hat, vor allem wenn sich die Bewerber klar darüber sind, dass es in Bayern kein Altersgeld gibt, also der Weg aus Bayern heraus (ohne Ländertauschverfahren) oder aus dem Lehrerberuf heraus schwierig bzw. sehr kostspielig ist.
Anmerkungen
Wie bereits erwähnt, ist das hier mein persönliches Bild was Wohnkosten usw. betrifft. Es kann sehr gut sein, dass jemand anderes zu einer anderen Einschätzung kommt, ob München die veranschlagten Wohnkosten durch seine Lebenesqualität und Angebote ausgleicht. Ganz anders sieht es natürlich auch aus, wenn man hier oder in gut pendelbarer Distanz Wohnraum geerbt hat. Trotzdem höre ich immer wieder, dass Lehrkräfte abwandern, weil das Wohnen in und um München mit Familie kaum bezahlbar ist. Wenn die Familie wächst, braucht man zum einen mehr Platz und zum anderen reduziert sich das Einkommen, weil i.d.R. mind. einer weniger arbeitet. Überspitzt: München ist ein Durchlauferhitzer für junge Lehrkräfte, in den nach dem Ref alle gesteckt werden, um ihn dann ziemlich bald (am Ende einer kompletten Lehramtsausbildung inkl. Ref ist man ja schon relativ alt) wieder zu verlassen. Für die Schulentwicklung hier ist das sicher keine einfache Herausforderung.
P.S.: Das war’s jetzt erstmal zu dem Thema von mir – Antrag ist gestellt und jetzt lasse ich mich überraschen, was passiert.